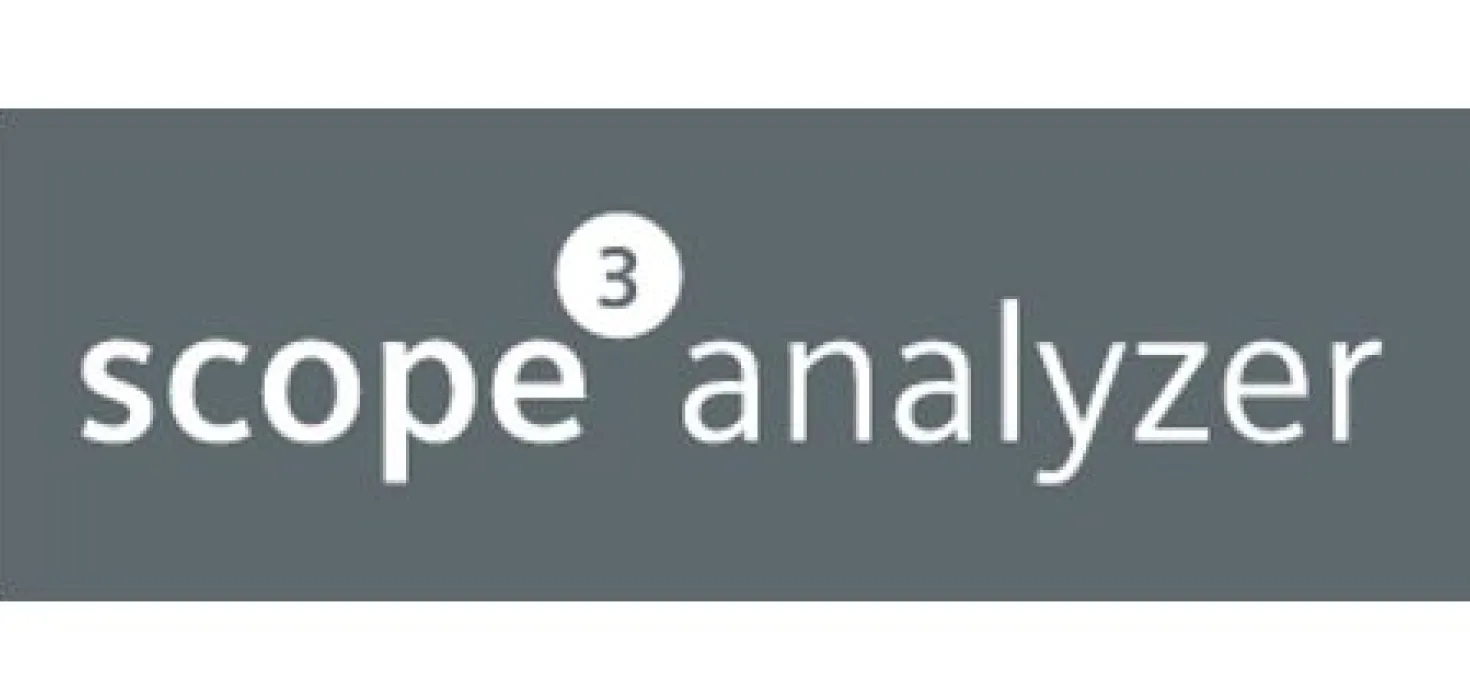Auf dem Weg zur Klimaneutralität: Tools die Ihnen dabei helfen
Die Transformation hin zur Klimaneutralität erfordert umfangreiche Informationen und oft auch spezielle Kenntnisse. Für Sie ist es entscheidend zu erkennen, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Deshalb finden Sie hier Erklärungen zu zentralen Fachbegriffen sowie Informationen zu Unterstützungstools und Fördermöglichkeiten.
Tools, THG-Rechner
Schulungen
Wir bieten für Sie Schulungen zu unterschiedlichen Themen an, die Sie optimal auf Ihrem Weg zum klimaneutralen Unternehmen begleiten, ganz gleich ob als Einsteiger, Fortgeschrittene oder Vorreiter:
- Schulungsreihe „Unternehmen machen Klimaschutz“: Als erste Anlaufstelle unterstützt und begleitet Sie das Kompetenzzentrum Klimaschutz in Unternehmen BW Schritt für Schritt auf Ihrem Weg Richtung Klimaneutralität. Die Schullungen schaffen Grundlagen und bieten weiterführende Unterstützung rund um unternehmerischen Klimaschutz.
- Ökodesign-Schulungen: In der Phase der Entwicklung und im Design gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Umweltauswirkungen eines Produkts zu verringern. Die Ökodesign-Schulung gibt Antwort unter anderem auf Fragen wie „Was macht ein gutes Ökodesign aus?“ und „Wie erstellt man eine Ökobilanzierung und welche rechtlichen Vorgaben gibt es zu beachten?“
Hier finden Sie eine Übersicht der Schulungstermine
Förderungen
Unternehmen machen Klimaschutz Beratungsförderung
Unternehmen machen Klimaschutz Investitionsförderung
Beratungsförderung BERE
- Jetzt mit vereinfachtem Antrag -
Bund- und Landesvorgaben, Standards und Handlungsanweisungen
Mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz wird das Ziel der Klimaneutralität um fünf Jahre auf 2045 vorgezogen. Der Weg dahin wird mit verbindlichen Zwischenzielen festgelegt.
Die Sektorziele für ein klimaneutrales Baden-Württemberg beschreiben einen Pfad, mit dem bis 2040 ein Gleichgewicht aus Emissionen und Senken erreicht werden kann.
Das GHG-Protokoll schafft umfassende, weltweit standardisierte Rahmenbedingungen für die Messung und das Management von Treibhausgasemissionen (THG) aus dem privaten und öffentlichen Sektor, aus Wertschöpfungsketten und aus Maßnahmen zur Emissionsminderung.
Glossar / Begriffserklärung
Der Corporate Carbon Footprint bezeichnet die Menge an Treibhausgasen, die direkt oder indirekt auf ein Unternehmen zurückzuführen ist. Dazu gehört nicht nur CO2, sondern auch andere Treibhausgase. Deshalb erfolgt die Berechnung in CO2-Äquivalent (CO2e).
Subglobal: Ebene von Ländern, Sektoren, Unternehmen oder Einzelpersonen.
Sogenannte Ansprüche (engl. Claims) von Unternehmen aus erreichter oder zu erreichender Klimaneutralität oder Netto-Null-Emissionen, beziehen sich auf die jeweils gewählte Systemgrenze. Die Systemgrenzen auf den unterschiedlichen Ebenen (Land, Unternehmen, Produkt, etc.) sind somit ausschlaggebend für den daraus resultierenden Anspruch auf Klimaneutralität oder Netto-Null-Emissionen.
Während die internationale THG-Bilanzierung auf territorialen Emissionen basiert und die Gesamtsumme an Emissionen umfasst, die bei der Herstellung von Waren und bei der Bereitstellung von Dienstleistungen in einem Jahr in einem Land oder Wirtschaftsraum freigesetzt werden, misst der THG-Fußabdruck alle Emissionen, die durch den inländischen Verbrauch verursacht werden.
Dies unterscheidet die staatliche von der unternehmerischen Treibhaugasbilanzierung, da letztere, wenn Scope 3 mit abgedeckt ist, auch die Emissionen der Lieferkette berücksichtigt.1
Der IPCC definiert Klimaneutralität auf globaler Ebene als ein Zustand, in dem menschliche Aktivitäten keine Nettoauswirkungen auf das Klimasystem haben (IPCC, 2018, Seite 545). Um einen solchen Zustand zu erreichen, müssten verbleibende Emissionen mit der Entnahme von Emissionen (Kohlendioxid) ausgeglichen und die regionalen oder lokalen biogeophysikalischen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten, die zum Beispiel das Rückstrahlvermögen (Albedo) der Erdoberfläche oder das lokale Klima beeinflussen, berücksichtigt werden.
Kohlenstoffneutralität strebt den Ausgleich zwischen anthropogenen CO2-Emissionen und THG-Senken an. Andere Treibhausgase werden (Methan, Distickstoffmonoxid, Fluorierte Gase, Schwefelhexafluorid, Stickstofftrifluorid, Perfluorierte Kohlenwasserstoffe) nicht berücksichtigt.1
Gemäß dem SR1.5 werden Netto-Null-Emissionen erreicht, wenn anthropogene THG-Emissionen in der Atmosphäre durch anthropogene Entnahmen von THG über einen bestimmten Zeitraum ausgeglichen werden (IPCC, 2018, Seite 555).
Dort, wo unterschiedliche THG involviert sind, hängt die Quantifizierung der Netto-Null-Emissionen von der gewählten Klimametrik zum Vergleich der verschiedenen Gase (z. B. Erderwärmungspotenzial, globales Temperaturveränderungspotenzial) ab (IPCC, 2018, Seite 555).
Generell setzt das Netto-Null-Konzept immer eine Bezugsgröße voraus, die variieren kann. Im Fall des Weltklimarats beziehen sich die Netto-Null-Definitionen auf THG-Emissionen.
Auf der globalen Ebene hat das Netto-Null-Konzept die gleiche Bedeutung wie die starke Definition der Treibhausgasneutralität: Beide beziehen sich auf ein Gleichgewicht zwischen (globalen) THG-Emissionen und -Entnahmen.1
Den Aktivitäten eines Akteurs sind über alle Bereiche (Scope 1-3) hinweg keine THG-Emissionen zuzuschreiben.2
Der Product Carbon Footprint bezieht sich auf die Menge an Treibhausgasen, die ein bestimmtes Produkt entlang des gesamten Lebenszyklus verursacht.
Generell weist der Begriff „Neutralität“ auf einen Zustand hin, in dem die Wirkungen zweier entgegengesetzter Einflussgrößen aufgehoben werden, da ihre Effekte gleich groß sind. Hinsichtlich der Stringenz des Neutralitätskonzepts kann zwischen einer „schwachen“ und einer „starken“ Definition auf der globalen Ebene unterschieden werden.
Schwache Neutralität
Die schwache Definition des Neutralitätskonzepts stützt sich auf den Ankauf von Emissionsgutschriften aus emissionsreduzierenden Aktivitäten, die anfallende Emissionen durch Minderungsmaßnahmen anderenorts ausgleichen.
Starke Neutralität
Alle THG-Emissionen weltweit vollständig eingestellt oder verbleibende THG-Emissionen durch den Ausbau von CO2-Senken ausgeglichen (neutralisiert) werden. Beim Ausgleich von THG-Emissionen mit THG-Senken kann sowohl von natürlichen Senken (z. B. Wälder, Böden) als auch von menschengemachten Senken (z. B. durch den Einsatz von Negativemissionstechnologien) Gebrauch gemacht werden.1
In der Science Based Targets Initiative (SBTi) haben sich das Carbon Disclosure Project (CDP), der United Nations Global Compact (UNGC), das World Resources Institute (WRI) und der World Wide Fund for Nature (WWF) zusammengeschlossen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Handeln so auszurichten dass das 1,5 °C-Ziel erreicht werden kann. Die SBTi hat Kriterien und Empfehlungen veröffentlicht, die von Unternehmen erfüllt werden müssen, damit SBTi die Unternehmensziele als wissenschaftsbasiert verifizieren kann.
Es gibt (aktuell) keine allgemein anerkannte Definition von Netto-Null und Klimaneutralität auf der Unternehmensebene.
Die Bedeutung von Klimaneutralität/Treibhausgasneutralität/Netto Null auf Unternehmensebene wird maßgeblich von verschiedenen Standards, Initiativen und Labeln beeinflusst, da sich die Unternehmen bewusst oder unbewusst an ihnen orientieren.
Die Gemeinsamkeit ist, dass alle drei eine bestimmte Definition von Klimaneutralität bzw. dem Netto-Null-Konzept sowie eine Methode zur Erreichung des Status „klimaneutral“ vorgeben. Zudem stellen sie überprüfbare Kriterien zur Erreichung von Klimaneutralität oder Netto-Null auf. Sie sollen somit zu mehr Klarheit und Transparenz beitragen.
Auf Unternehmensebene muss daher die Aussage „Klimaneutral/Netto-Null“ immer in Verbindung mit dem entsprechenden Standard/Label/Initiative gesehen werden.
Für die Treibhausgasbilanzierung ist das Greenhouse Gas Protocol mit dem „The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard“ und dem „Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard“ maßgebend.
Die unter Unternehmen aktuell verbreitetste Initiative zur Klimazieldefinition ist aktuell die Science Based Targets initiative mit den Standards SBTi Corporate Net-Zero Standard Criteria und SBTi Corporate Near-Term Criteria.1
Im Mai 2024 wurden von dem Oxford Net Zero Forschungsteam 37 relevante Ressourcen im freiwilligen Markt auf ihre Lücken und Konvergenzen untersucht. Diese Analyse zeigte, dass die bestehenden Empfehlungen zum Handeln oder zur Offenlegung von Aktivitäten bei folgenden Punkten variieren (und verbessert werden könnten):
- Bessere Definition „relevanter“ Emissionsquellen für Scope-3-Ziele
- Klarheit darüber, wie das Basisjahr für die Berechnungen der Ziele und Emissionsreduktionen ausgewählt werden sollte
- Beschaffung als wesentliche Möglichkeit zur Dekarbonisierung der Wertschöpfungsketten von Organisationen
- Einigkeit darüber, dass Kompensationen nur zur Neutralisierung von Restemissionen verwendet werden sollten, um Netto-Null zu erreichen, und nicht zur Erreichung von Zwischenzielen, aber „Restemissionen“ nur unzureichend definiert sind (obwohl viele Quellen die Definition auf 5-10 Prozent der Gesamtemissionen begrenzen)
- Die Definitionen von Zusätzlichkeit und Dauerhaftigkeit bei der Verwendung von Gutschriften, Kompensationen und Senken ist unzureichend
- Festlegung der Häufigkeit, mit der Übergangspläne und Ziele aktualisiert werden sollten
- Empfehlung, dass Geschäftsmodelle mit einer Netto-Null-Welt kompatibel sein sollten.2
THG-Neutralität strebt den Ausgleich zwischen anthropogenen THG-Emissionen und THG-Senken an. Biogeophysikalische Auswirkungen werden nicht berücksichtigt. Umgangssprachlich wird unter Treibhausgasneutralität Klimaneutralität verstanden.1
Science Based Targets (SBT) sind Klimaziele, die sich am aktuellen wissenschaftlichen Konsens und dem Pariser Klimaabkommen orientieren. SBT liefern eine sinnvolle und nachvollziehbare Grundlage, im Gegensatz zu willkürlichen Zielen.
Dieser Begriff beschreibt das Ziel, den menschengemachten globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Gerechnet wird dabei vom Beginn der Industrialisierung bis zum Jahr 2100. Als vorindustriell wird der Mittelwert der Jahre 1850 bis 1900 verwendet.
1 Deutsche Energie-Agentur (dena, 2020): „dena-Analyse: Klimaneutralität – ein Konzept mit weitreichenden Implikationen“ Honegger, M.; Schäfer, S.; Poralla, P.; Michaelowa, A.; Perspectives Climate Research gGmbH, Freiburg i. Br.
2 Net Zero Climate: https://netzeroclimate.org/what-is-net-zero-2/